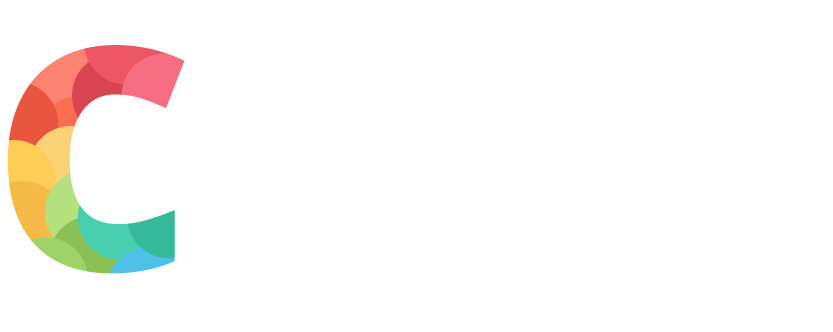Zentrales Thema waren die Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2022, die von Prof. Dr. Ul-rich Schraml (FVA BW) und Landesforstpräsident Martin Strittmatter (MLR Baden-Württem-berg) vorgestellt wurden. Die Inventur zeigt: Die Wälder in Baden-Württemberg sind vielfäl-tiger geworden, stehen aber unter Stress. Mischwälder und Biotopbäume nehmen zu, der Holzvorrat ist hoch – doch gleichzeitig nimmt der Holzzuwachs ab, und alte Nadelholzbe-stände geraten zunehmend unter Druck.
„Die Bundeswaldinventur zeigt deutlich: Unsere Wälder befinden sich im Wandel. Wenn wir ihre Funktionen für Klima, Biodiversität und Rohstoffversorgung erhalten wollen, müssen wir sie aktiv gestalten“, erklärte Prof. Schraml.
Prof. Dr. Steffi Heinrichs (HFR) warf einen forstökologischen Blick in die Zukunft. Sie stellte heraus, dass sich die heutigen Hauptbaumarten durchaus teilweise an klimatische Verände-rungen anpassen können, sich aber unter dem Druck des Klimawandels Verschiebungen in-nerhalb dieser Gruppen abzeichnen. Außerdem können besser klimatisch angepasste andere Baumarten unsere Hauptbaumarten künftig ergänzen. Heinrichs plädiert für eine differen-zierte Waldstrategie: Baumarten, die wahrscheinlich zur künftigen potenziellen natürliche Vegetation (PNV) gehören (z.B. Eichen- und Sorbusarten), sollten gezielt gefördert werden – durch angepasste Wildbestände, geeignete Durchforstungsstrategien und die Reaktivierung traditioneller Nutzungsformen. Gleichzeitig betonte sie: Zum Erhalt der Produktivität ist Na-delholz unverzichtbar. Ein nach Standorten differenzierter Ansatz könne zu einer Art „funkti-onaler Segregation“ führen – mit stabilen Laubmischwäldern auf klimaanfälligen Standorten und produktiven Nadelholzbeständen auf Standorten, wo sie auch künftig risikoarm wachsen können.
Franz-Josef Risse vom Kreisforstamt Reutlingen berichtete aus der kommunalen Praxis. Die Veränderungen der Gemeindewälder im Landkreis Reutlingen führen zu vielfältigen Heraus-forderungen – insbesondere bei der Verkehrssicherheit, dem Wildverbiss und der Arbeitssi-cherheit. Risse stellte das Pilotprojekt zur allgemeinen Gefährdungsbeurteilung vor, das in Reutlingen gestartet ist. Zudem setzt der Landkreis auf Privatwald- und Dauerwaldschulun-gen, um Waldbesitzende besser für die Klimaanpassung ihrer Wälder vorzubereiten.
Prof. Dr. Bertil Burian (HFR) machte in seinem Beitrag deutlich: Holznutzung und Klimaschutz schließen sich nicht aus – im Gegenteil. Der Holzbau könne durch CO₂-Speicherung außer-halb des Waldes und Substitution emissionsintensiver Baustoffe eine zentrale Rolle im Klima-schutz spielen. Der Fokus müsse allerdings stärker auf die nachhaltige Nutzung regionaler Holzvorräte gelegt werden.
„Das Bauen mit Holz ist klimapositiv. Wir müssen dieses Potenzial nutzen – für den Klima-schutz, für regionale Wertschöpfung und für die Bauwende“, betonte Burian.
Dr. Tatjana Spallek (HFR) schloss die Vortragsreihe mit einem inspirierenden Beitrag über das Potenzial des Rohstoffs Holz. Sie zeigte eindrucksvoll, dass Holz weit mehr kann als Bau und Brennstoff: Inzwischen entstehen Papier, Textilien, Kunststoffe, Biochemikalien und sogar Modekollektionen aus Holzbestandteilen.
„Holz ist eine unerschöpfliche Quelle für Wertschöpfung – ein Rohstoff, der fossile Materia-lien ersetzen kann. Holz kann alles!“, betonte Spallek.
Die Diskussion zeigte: Eine rein passive Walderhaltung greift zu kurz. Es braucht aktive Wald-pflege, forstliche Beratung für Waldbesitzende und politische Unterstützung, um die Wälder für das sich drastisch verändernde Klima fit zu machen. Die HFR will diesen Dialog über span-nende Wald- und Umweltthemen weiterführen – im Schulterschluss von Wissenschaft, Pra-xis und Gesellschaft.
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Schadenweilerhof
72108 Rottenburg am Neckar
Telefon: +49 (7472) 951-0
Telefax: +49 (7472) 951-200
http://www.hs-rottenburg.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle
Telefon: +49 (7472) 951-282
Fax: +49 (7472) 951200
E-Mail: Pe.martin@hs-rottenburg.de
![]()