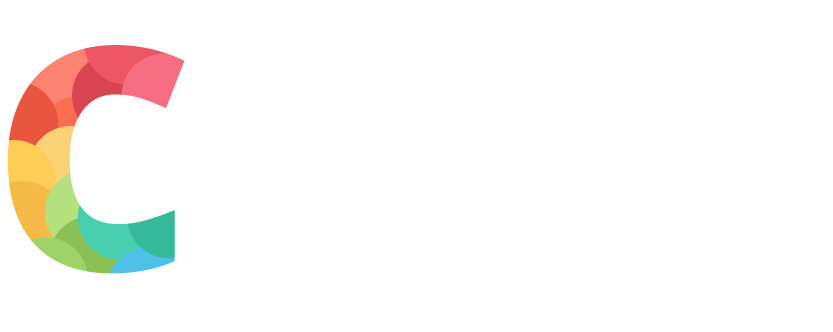Hi Collette und Tom. Bevor wir über Euer Start-up sprechen, können wir vielleicht einen Schritt zurückmachen und ihr könnt uns zunächst etwas über Euren Hintergrund erzählen. Woher kommt ihr? Was hat ihr vorher beruflich gemacht und warum habt ihr den Schritt ins Start-up-Geschäft gewagt?
Collette: Ich komme aus dem Designbereich und habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, viele Jahre als Executive Creative Director in der Marken- und Werbewelt gearbeitet. Aber mit der Zeit wurde ich desillusioniert – zuckerhaltige Getränke an Jugendliche und Kreditkarten an Familien zu verkaufen, die nicht noch mehr Schulden brauchen, gefiel mir einfach nicht mehr. In den letzten drei Jahren wurde ich Teil der Berliner Start-up-Szene, die die Lücke zwischen Marke, Marketing und Produkt schließt. Daneben hatte ich schon immer eine tiefe Liebe für kleine Lebewesen – vor allem für Insekten und die Tiere, die sie fressen – Kröten, Eidechsen, Igel und Vögel. Als ich in Südafrika aufwuchs, sah ich, wie sie langsam verschwanden. Ich wollte verstehen, warum das so ist – und als ich mich umschaute, stellte ich fest, dass es erstaunlich wenig Forschung zu diesem Thema gab. So entstand die Idee zu SPAIA und auch der Punkt, an dem Tom ins Spiel kommt.
Tom: Ich bin ein kreativer Technologe und Software Developer mit einem Hintergrund, der von Sales über Digital Experience Design bis hin zur Werbung reicht – so habe ich beispielsweise einmal Beatboxing für Cola-Dosen gemacht – aber auch integrierte Systeme und angewandte KI-Plattformen aufgebaut. All diese verschiedenen Welten, verbindet eine Überzeugung, die ich habe: Technologie kann uns enger mit der physischen Welt verbinden, nicht nur mit der digitalen Welt. Vor etwa 11 Jahren begann ich, mit „Wildbiene + Partner“ zusammenzuarbeiten und Software für die Verwaltung von Wildbienenpopulationen zu entwickeln. Dieses Projekt war ein Wendepunkt für mich. Es öffnete mir die Augen dafür, wie wenig wir eigentlich über die Insekten wissen, die unsere Nahrung bestäuben, unsere Ökosysteme aufrechterhalten und im Stillen unseren Planeten am Laufen halten. Was ich herausfand, war sowohl faszinierend als auch alarmierend: Die Daten waren einfach nicht vorhanden. Nicht einmal für Bienen – die wohl beliebtesten Insekten. Diese Erkenntnis war der Startschuss für eine tiefere Reise in die Welt der Insekten und die unsichtbare Rolle, die sie spielen. Sie löste auch eine Frage aus: Wenn Insekten die Echtzeit-Vitaldaten der Natur sind, warum hören wir dann nicht auf sie? Das ist die Frage, zu deren Beantwortung wir SPAIA ins Leben gerufen haben.
Mit SPAIA entschlüsselt ihr diese „unsichtbare“ Umweltintelligenz und verwandelt den Puls der Natur in einen neuen Datensatz für nachhaltiges Umweltmanagement. Könnt ihr erklären, wie ihr Eure Vision zu einer Aufgabe gemacht und beschlossen habt, daraus ein Unternehmen zu machen?
Collette: Ein Wendepunkt für uns war eine Studie aus Deutschland, die Hallmann et al-Studie[1], die 2017 veröffentlicht wurde. Sie beschrieb einen Rückgang der Insektenmasse um 75 % in den letzten 27 Jahren. Und natürlich griff die Presse das auf und verkündete die Insektenapokalypse. Als wir uns die Zahlen ansahen und feststellten, dass diese sehr begrenzten Daten aus Naturschutzgebieten stammten, wussten wir, dass wir ein umfassenderes Bild brauchten, um das Problem anzugehen. Wir brauchten mehr Insektendaten von verschiedenen Orten. Außerdem wurde uns klar, dass dieses Problem nicht von zwei Personen allein gelöst werden kann. Wir mussten ein Unternehmen gründen, um das Thema nachhaltig anzugehen, und gleichzeitig Gleichgesinnte um uns versammeln, Forscher*innen, wissenschaftlich interessierte Bürger*innen und andere Unternehmen. Das ist es, was wir mit der Gründung von SPAIA erreichen wollten: Nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Bewegung.
Tom: Unser allererster Prototyp war ein sehr einfaches Gerät, mit dem wir versuchten, Bewegungen vor einem Wildbienennest zu erkennen, um zu sehen, wann die Aktivität bei den Insekten einsetzt. Das brachte uns dazu, über die Analyse von Standbildern hinaus über Insekten in Bewegung nachzudenken. Und wir fragten uns, ob wir Insektenpopulationen anhand ihrer Bewegung und Aktivität besser verstehen können.
Collette: Gleichzeitig dachten wir, es wäre interessant herauszufinden, wie die Bedingungen sind, unter denen die Population vieler Insekten steigt im Vergleich zu den Bedingungen, unter denen die Populationen sinken. Die Hallmann-Studie war eine Langzeitstudie, die in Deutschland durchgeführt wurde. Aber es gibt nur sehr wenige andere Langzeitstudien, die sich mit Insekten im Allgemeinen und ihrer Biomasse befassen. Daher bestand auch nicht die Möglichkeit einer Metastudie. Derzeit können wir einfach nicht sagen, wie viele Insekten es auf dem Planeten gibt und welche Bedingungen sie brauchen. Vor allem aus Gebieten, wie dem globalen Süden – wo wir herkommen – haben wir keine Daten, obwohl diese zu den artenreichsten Gebieten der Erde gehören.
Klar ist nun, woher eure Leidenschaft kommt, aber warum ist das für die Industrie so wichtig und was haben Insekten mit Biodiversität zu tun?
Collette: Insekten machen zwischen 60 und 80 % aller bekannten Tierarten auf unserem Planeten aus. Sie sind die Grundlage gesunder Ökosysteme und haben direkte Auswirkungen auf Schlüsselsektoren wie die Land- und Forstwirtschaft, die ESG-getriebene Landregeneration und sogar auf Bereiche wie erneuerbare Energien und Wassermanagement, und natürlich können sie verheerende Krankheitsüberträger sein. Trotzdem fehlen uns immer noch qualitativ hochwertige Echtzeitdaten über Insekten, die für eine proaktive Entscheidungsfindung erforderlich sind. Es ist verrückt, aber die Untersuchung von Insektenpopulationen wird immer noch weitgehend auf die gleiche Weise durchgeführt wie vor 100 Jahren. Sie ist begrenzt auf artspezifische Datenerfassung und arbeitsintensive Feldforschung – Menschen auf Feldern mit Netzen und Klemmbrettern. Dieser eingeschränkte Ansatz hat es fast unmöglich gemacht, das Gesamtbild der von Insekten verursachten Veränderungen in Ökosystemen zu erfassen. Das Wort Biodiversität ist aktuell ein Trendwort. In Gesprächen mit vielen Menschen haben wir jedoch festgestellt, dass dieser Begriff allgemein nicht verstanden wird. Wir verwenden viel Zeit und Geld auf die Erhaltung seltener Arten wie Pandas und Nashörner. Aber viele der häufigeren Arten sind in Wirklichkeit wichtiger für funktionierende Ökosysteme, denn diese Arten sind die Nahrungsquelle für andere oder tragen zur Bestäubung und zur Bodengesundheit für das Pflanzenwachstum bei. Es gibt Insektenpopulationen, deren Verlust zum jetzigen Zeitpunkt den Zusammenbruch der Ökosysteme zur Folge hätte.
Tom: Der Verlust der biologischen Vielfalt ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein finanzielles. Wenn Bestäuber verschwinden, fallen Ernten aus. Wenn Wälder sterben, brechen Lieferketten zusammen. Laut der Norges Bank, die den größten Staatsfonds der Welt verwaltet, erfüllen nur 32 % ihrer über 9000 globalen Unternehmen die grundlegenden Erwartungen an das Risikomanagement im Bereich Biodiversität.[2] Ein Wert von 32 % bedeutet, dass das Risiko der Natur für die meisten Unternehmen immer noch unsichtbar ist – und das ist ein ernstzunehmender toter Winkel. Dabei geht es nicht nur um das Umarmen von Bäumen – es geht auch um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, um regulatorische Risiken und, einfacher gesagt, um die Fähigkeit, weiter Geschäfte zu machen. Wenn Sie dieses Risiko nicht im Auge behalten, steuern Sie Ihr Unternehmen nicht – Sie spielen damit.
Aber wie löst ihr das Problem? Welche Technologie steckt hinter eurer Idee und wie arbeitet ihr dabei mit dem Fraunhofer IZM und insbesondere mit der Abteilung R3S und Start-a-Factory zusammen?
Collette: SPAIA baut das erste skalierbare, globale Netzwerk von Insektendaten auf, das kostengünstige Hardware und KI-gestützte Software integriert, um Insektenaktivitäten und deren Biomasse in Echtzeit zu erfassen – und das in einem noch nie dagewesenen Umfang. Unser System erfasst die Aktivität von Insekten und SPAIA schafft einen einfachen, skalierbaren Weg, die Welt durch Insekten zu verstehen. Wir bauen ein globales Netzwerk intelligenter Insekten Monitoring Systeme auf, die die Aktivität der Insekten und die lokalen Umweltbedingungen in Echtzeit verfolgen. Unsere kostengünstige Hardware und unsere KI-gestützte Plattform helfen Landverwaltern, Unternehmen und Gemeinden dabei, zu erkennen, was vor Ort geschieht – ob es sich um frühe Anzeichen für die Erholung eines gesunden Ökosystems oder um plötzliche Umweltveränderungen in die falsche Richtung handelt. Das System kombiniert Sensordaten, intelligente Erkennung sowie Eingaben von lokalen Nutzer*innen, um reine Insektenaktivitäten in klare, nützliche Erkenntnisse zu verwandeln – wie Karten, Trends, Fotos und Handlungsempfehlungen. Es ist ein Werkzeug für jeden, der Land verwaltet – angefangen bei Ökologen und ESG-Teams – um die biologische Vielfalt proaktiv zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen und bessere Entscheidungen zu treffen, die durch echte Daten gestützt werden.
Tom: Die Geräte, die wir im Moment pilotieren, verwenden eine Kamera und wir haben eine rein algorithmische Bildanalyse verwendet. Der Grund, warum wir am Fraunhofer IZM und in der Start-A-Factory sind, ist, dass wir ein 60-GHz-Radar getestet haben um zu eruieren, welche Größe von Insekten wir mit dem Radar erkennen können. Letztes Jahr hatten wir die Geräte im Sommer drei Monate lang im Feldtest in Zürich, dieses Jahr werden wir die Geräte für die Sommersaison einsetzen. Einige der Geräte testen wir für eine Woche, andere werden für eine längere Testzeit dortbleiben. Und warum? Weil eines der Probleme bei der Umweltberichterstattung derzeit darin besteht, dass die Berichtszeiträume kurz sind, wenn man mit Ökologen vor Ort zusammenarbeitet. Ein einziger Schlechtwettertag kann die Ergebnisse völlig verfälschen. Gemeinsam mit der MotionLab Berlin-Community haben wir die ersten 25 Geräte für unsere nächste Serie von Pilotprojekten gebaut. Unser nächster Schritt ist es, eine Reihe von 100 Geräten zu bauen, die wir alle gleichzeitig einsetzen können, um hochauflösende Vergleichsdaten aus verschiedenen Landnutzungsfällen zu sammeln.
Was SPAIA bisher erreicht hat:
- ? Bildgestütztes Monitoring System: Erfolgreiche Erkennung von Insektenaktivitäten unter realen Bedingungen.
? Erste Piloteinsätze: Vision-basierte Insektenerkennung und mikroklimatische Korrelation in aktiven Tests. - ? Fraunhofer-Kooperation: Validierung der radargestützten Insektenerkennung in Labortests, jetzt Vorbereitung auf den Einsatz im Feld und erweiterte Tests mit alternativen Sensoren.
- ? Von der Gemeinschaft gesteuerte Skalierung: Veröffentlichung des Open-Source-Handbuchs für DIY-Monitore (v1) unter Einbeziehung der Maker- und DIY-Tech-Community für Feedback und Iteration.
- ? Zweite Welle von vier Piloteinsätzen gesichert: Ausweitung auf Projekte zur Flächensanierung und Überwachung der biologischen Vielfalt in Städten in enger Zusammenarbeit mit Ökologen, die auf räumliche Interaktion spezialisiert sind, um unsere Datenmodelle und unseren Ansatz zu verfeinern und breitere Anwendungen in der Industrie zu validieren.
Collette: Gemeinsam mit den Radarexperten des Fraunhofer IZM haben wir eine Studie über die Machbarkeit der Erkennung von Insekten mit Radar durchgeführt. Wir hatten auch wertvolle Diskussionen mit den Expert*innen aus der Abteilung ERE zur Nachhaltigkeit, die uns Einblicke in die Erweiterung unserer Anwendungsbereiche gaben und uns mit einigen unserer neuen Pilotpartner zusammenbrachten. Am wichtigsten waren und sind Ulf Oestermann und Alexandra Rydz – die Köpfe hinter Start-A-Factory: Sie haben uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden, basierend auf ihrem tiefen Verständnis der Hardware-Industrie, welche so viel komplexer ist als die der Software-Branche. Es gibt einen Grund, warum man es ‚Hard Tech‘ nennt, denn es ist schwierig!
Tom: Ich finde, die Erfahrung und Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern ist phänomenal. Wenn man sich das Radar-Team der Abteilung R3S ansieht: Man braucht viel Erfahrung, um solche Ergebnisse zu erzielen. Ohne die Zusammenarbeit bräuchten wir Hunderte von Stunden und Zehntausende von Euro, um die Ausrüstung zu beschaffen und die Versuche selbst durchzuführen.
Warum habt ihr Euer Startup in Deutschland gegründet? Gibt es nicht an anderen Orten der Welt viel mehr Insektenarten?
Collette: Aus der Sicht der Forschung verfügt Deutschland über unglaubliche Einrichtungen, die sich mit der biologischen Vielfalt und der Ökologie der Arteninteraktion befassen. Außerdem gibt es hier einige der besten Biodiversitätsprogramme für Forschende in Europa. Ganz zu schweigen davon, dass Deutschland im Hinblick auf die Insektenschutzgesetze bereits recht weit fortgeschritten ist. In vielen anderen Ländern ist die Gesetzgebung aus Sicht der Wirtschaft nicht so weit fortgeschritten wie in der EU, wenn es um Nachhaltigkeit, Biodiversität und vieles mehr geht. Also alles in allem, ist Deutschland ein perfekter Fit für uns. Und die Zusammenarbeit mit Weltklasse-Instituten wie dem Fraunhofer IZM oder Ökosystemen wie dem MotionLab Berlin war für uns ebenfalls sehr attraktiv. Die Hard-Tech-Startup-Szene in Berlin ist voller Potenzial.
Wir sind auch sehr froh, Euch hier zu haben und mit Euch die Botschaft von SPAIA aus Deutschland in die ganze Welt zu tragen. Aber wie lange bleibt ihr noch bei uns am Fraunhofer IZM und was sind Eure nächsten Schritte?
Collette: Der erste Iteration mit den Expert*innen des Fraunhofer IZM im Rahmen der Machbarkeitsstudie ist erfolgreich abgeschlossen und wir konnten das Radar als Erfassungslösung validieren. Wir sind dabei, verschiedene weitere Forschungs- und Entwicklungszuschüsse zu beantragen, viele davon in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IZM und Start-a-Factory.
Tom: Wir wollen weiterhin leidenschaftlich Open Source zur Verfügung stellen und freuen uns sehr, unsere Arbeit zu teilen und zu veröffentlichen. Natürlich suchen wir auch dafür weitere Zusammenarbeit mit allen Interessierten und Kooperationen. Ich denke, unser nächster Schritt, auf den wir sehr gespannt sind, ist, echte Insekten in die Labore des Fraunhofer IZM zu bringen und zu überprüfen, ob wir die gleichen Ergebnisse erzielen können. Außerdem steht demnächst ein weiterer Einsatz an, bei dem wir zusammen mit einer Organisation aus dem Bereich der Reallabore, die winzige Wälder entwickelt („Kiezwald“), im „Moawald“ in Moabit unsere Prototypen installieren werden. Wir installieren die Geräte gemeinsam mit ihnen, um ihren städtischen Wald zu überwachen und die Auswirkungen zu ermitteln. Und schließlich wollen wir die Software für unsere Community öffnen, damit sie sich die Ergebnisse aus dem Feld ansehen können. Jedes Gerät soll eine eigene Seite auf unserer Website bekommen, auf der man sich anmelden und feststellen kann, ob Insekten an dem Ort vorkommen oder nicht. Wir werden diese Daten nutzen, um unsere Algorithmen zu verbessern. Es gibt also noch eine Menge Pläne und kein Ende.
Mehr Informationen über SPAIA: https://www.spaia.earth/
[1] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
Über das Fraunhofer IZM:
Hoch integrierte Mikroelektronik ist allgegenwärtig und bleibt doch fürs bloße Auge meist unsichtbar. Seit über 30 Jahren unterstützten wir an den Standorten Berlin, Dresden und Cottbus Startups sowie mittelständische und internationale Großunternehmen mit Technologietransfer für intelligente Elektroniksysteme der Zukunft. Das Fraunhofer IZM deckt mit vier zentralen Technologie-Clustern eine große Bandbreite aus den Bereichen Quantentechnologie, Medizin-, Kommunikations- und Hochfrequenztechnik ab. Mit unserer weltweit führenden Expertise bieten wir unseren Kund*innen kostengünstige Entwicklung und Zuverlässigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien sowie maßgeschneiderte Systemintegration auf Wafer-, Chip- und Boardebene.
Über Start-A-Factory:
Start-A-Factory bringt Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen schnell von der ersten Idee bis zum ersten professionellen Prototypen – mithilfe von modernsten Anlagen, eingebettet in das Netzwerk von Fraunhofer IZM-Wissenschaftler*innen und anderen unterstützenden Partnern. Dabei bleibt das Entwicklungsteam maximal involviert, indem wir eine unterschiedliche Intensität von professioneller Unterstützung ermöglichen. Aufwandsschätzung und Entwicklungszeiten sind individuell: basierend auf einem ersten Workshop erarbeitet wir gemeinsam mit dem Entwicklungsteam eine Roadmap. So ist jede Lösung maßgeschneidert. Start-A-Factory bringt Entwicklungsteams und unterstützende oder Kooperationspartner zusammen – dies bietet exzellente Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektentwicklung. Vertrauen ist unser größtes Pfund und deshalb nehmen wir in der Start-A-Factory keine Anteile. Das »Intellectual Property« bleibt zu 100% beim Entwicklungsteam. Mehr Informationen: https://www.start-a-factory.com/
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
Telefon: +49 (30) 46403-100
Telefax: +49 (30) 46403-111
http://www.izm.fraunhofer.de
Presse
E-Mail: susann.thoma@izm.fraunhofer.de
Marketing
E-Mail: alexandra.rydz@izm.fraunhofer.de
![]()